Das Potential audiomedial gestützter Lesetrainings zur Verbesserung der Lesegeschwindigkeit und der Dekodierfähigkeit
Eine empirische Untersuchung zu kombinierten Laut- und Vielleseverfahren in Leseprojekten für die 2. Jahrgangsstufe
Julia Ehrhardt
PH Freiburg, 2018
Den gesamten Text können Sie als PDF hier herunterladen:
Leseflüssigkeit und ihre Bedeutung für die Lesekompetenz
Förderelemente im Bereich Lesen können nach dem didaktischen Modell von Rosebrock und Nix (2014, s.u.) auf der Prozessebene, der Subjektebene und der sozialen Ebene angesiedelt sein. Als grundlegende Voraussetzung für die Förderung hierarchiehöherer Prozesse des Lesens, wie z.B. die Bildung globaler Kohärenz, gilt die Förderung von hierarchieniedrigen Prozessen (vgl. Rosebrock/Nix 2014: 18). Diese können beispielsweise in Form eines Leseflüssigkeitstrainings zur Steigerung der Lesegeschwindigkeit und der Dekodierfähigkeit gefördert werden.
WAS IST LESEFLÜSSIGKEIT?
Leseflüssigkeit wird nach Rosebrock und Nix definiert als „die genaue, automatisierte, schnelle und sinnkonstituierende Fähigkeit zur leisen und lauten Textlektüre, die es dem Leser ermöglicht, die Bedeutung eines Textabschnittes mental zu konstruieren“ (Rosebrock/Nix 2006: 93). Sie setzt sich aus den vier Teildimensionen Genauigkeit des Dekodierens, Automatisierung des Dekodierens, Lesegeschwindigkeit sowie Segmentierung & Betonung zusammen, die in engem Zusammenhang stehen (vgl. Rosebrock et al. 2011: 16). Das offensichtlichste Merkmal zur Identifizierung disfluenter Leser ist die Lesegeschwindigkeit (vgl. Nix 2011: 17f), welche u.a. mithilfe von Lückentexten zur Gruppendiagnostik gemessen werden kann, aber auch mit einem Lautleseprotokoll.
WARUM IST LESEFLÜSSIGKEIT WICHTIG?
Die Wichtigkeit ausreichender Leseflüssigkeit belegen Untersuchungen, die zeigten, dass 4. Klässler mit mangelnder Leseflüssigkeit diesen Rückstand bis zur 8. Klasse nicht aufholten, sondern weiter ausbauten (vgl. Klicpera/Gaseiger-Klicpera 1993: 57).
Durch ein frühzeitiges Leseflüssigkeitstraining wird nicht nur die Grundlage für die Förderung hierarchiehöherer Prozesse geschaffen, sondern durch die Automatisierung basaler Lesefertigkeiten steht beim Leser zusätzlich mehr Kapazität zur kognitiven Verarbeitung des Textes zur Verfügung (vgl. Rosebrock et al. 2011: 10f). Diese Lernprozesse der basalen Lesefertigkeiten auf der Buchstaben-, Wort-, und Satzebene sollten in dem hier vorgestellten Projekt fokussiert werden.
EINE VARIANTE DES LESEFLÜSSIGKEITSTRAININGS
Kann ein Leseflüssigkeitstraining mit zusätzlichem Audiomaterial einen höheren Kompetenzzuwachs der Lesekompetenz bei Schüler/innen erzielen als Leseflüssigkeitstrainings, die ausschließlich auf Printmedien basieren? Dieser Frage gilt es nachzugehen, um Leseförderung möglichst systematisch und individuell passgenau zu gestalten. Bisher fanden Forschungsarbeiten zu diesem Thema hauptsächlich im Bereich der Sekundarstufe I statt, welche die Wirksamkeit des zusätzlichen Audiomaterials belegen (vgl. Gailberger 2011/2013).
Projektbeschreibung „Wir werden Lesestars“ – Klasse 2
Das durchgeführte Leseflüssigkeitstraining lässt sich als Kombination aus Laut- und Vielleseverfahren beschreiben, bei dem 2. Klässler/innen jede Woche ein neues kurzes Buch ausleihen und wiederholt lesen. Das Training wurde in zwei verschiedenen Versionen mit zusätzlicher Kontrollgruppe durchgeführt. Generell basiert das Lesetraining auf dem wiederholten (Laut-) Lesen, dessen Effektivität bereits in vielen Studien bestätigt wurde (vgl. Kawohl 2015: 118).
GRUNDIDEE UND ABLAUF DES PROJEKTES
| Klasse A | Klasse B | Klasse C | |
| Art des Trainings | Mitleseverfahren/Vielleseverfahren | Lautleseverfahren/Vielleseverfahren | Kontrollgruppe:KeineFörderung |
| Ziel | Leseflüssigkeitstraining zur Förderung der basalen Lesefertigkeiten – insbesondere der Lesegeschwindigkeit und der Dekodierfähigkeit | ||
| Übungsmaterial | Bücher (ca. 450 – 1300 Wörter) + Audiomaterial | Bücher (ca. 450 – 1300 Wörter) | |
| Übungseinheiten | 5 mal 10 Minuten pro Woche | 5 mal 10 Minuten pro Woche | |
| Zeitraum | 6 Wochen | 6 Wochen | |
Wie bereits weiter oben gesagt bezieht sich Leseflüssigkeitstraining vor allem auf die Prozessebene und hier wiederum auf die Förderung der hierarchieniedrigen Prozesse. Allerdings fördert das hier vorgestellte Projekt außerdem Lesemotivation und damit wird auch die Subjektebene berücksichtigt.
LEHRER- UND SCHÜLERROLLE
Im Projekt sind die Rollen von Lehrkraft und Lernenden klar definiert. Eine kurze Zusammenstellung kann der folgenden Tabelle entnommen werden.
| Lehrer/innen | Schüler/innen |
| - Planung, Organisation und Koordination des Büchertauschs- Durchführung des Projektabschlusses- Moderation und Führung der Rückmeldungsgespräche | - Durchführung der Übungsphasen- Dokumentation des Leseprozesses in einem Lesetagebuch- Reflexion ihres Lernprozesses |
ELEMENTE DES LESEFLÜSSIGKEITSTRAININGS – WORAUF IST ZU ACHTEN?
| Übungsphasen | Mindestens 6 Wochen, 5 mal 10 Minuten pro Woche- differenzierte Förderung durch unterschiedliche Geschwindigkeiten des Audiomaterials- aus dem Unterricht ausgelagert und weitgehend selbständig von den Schüler/innen durchgeführt |
| Übungsmaterial | |
| Bücher | Überschaubare Textmenge, sprachliche Einfachheit und Verständlichkeit (vgl. Groeben 1982: 217), thematische Variation, unterstützende Illustrationen, Reihe für Leseanfänger, z.B. Minimax des Beltz Verlages→ Wichtig: Buchwünsche der Kinder möglichst berücksichtigen |
| Audiomaterial | Kurze Anweisung zu Beginn der beigelegten CD, unterschiedliche Vorlesegeschwindigkeiten zwischen 60 und 80 Wörtern pro Minute (vgl. Klicpera/Gasteiger-Klicpera 1993: 54) je nach Altersstufe, akustisches Knacken als Signal für das Umblättern |
| Lesetagebuch | Funktionen: Leseziele im Vorfeld festlegen, Dokumentation und Einschätzung der Übungseinheiten durch die Schüler/innen, kleine Schreibaufgaben zum Buch |
| Zeitlicher Ablauf1. Erhebung der Lesegeschwindigkeit durch Leseflüssigkeitstests2. Durchführung des Projektes2.1 Projektvorstellung- Sinnhaftigkeit des Übens vermitteln- Kriterien für gutes Lesen und Leseziele festhalten- Besprechen des Projektablaufs, der Dokumentation der Lesezeiten im Lesetagebuch und der Durchführung des Übens mit oder ohne Audiomaterial2.2 Übungsphase- Büchertausch: Erstellung eines Verteilungsplans, Festlegen eines wöchentlichen Tauschtags, Mappen zur Aufbewahrung der Bücher- Belohnung für das Absolvieren einer Projektwoche (z.B. einen Stern auf ein Plakat aufkleben)- zusätzlicher Leseflüssigkeitstest nach der 3. Projektwoche für individuelles Feedback im Einzelgespräch- Rückmeldungsrunden im Plenum 2.3 Projektabschluss- Einschätzung der Kinder, ob zu Beginn gesetzte Leseziele erreicht wurden- Abschlussveranstaltung, z.B. Hörspiel aufnehmen im Tonstudio (PH Freiburg), Produktion einer eigenen CD/Audiodatei, Literaturcafe--> vermittelt Sinnhaftigkeit des Lesetrainings und motiviert3. Diagnose des Kompetenzzuwachses mittels Leseflüssigkeitstestsà Lückentexte zur Diagnose der Lesegeschwindigkeit an verschiedenen Zeitpunkten (vor Beginn des Projektes, nach 3 Wochen und nach Beendigung des Projektes) | |
| Rückmeldung | Rückmeldungsrunden im Plenum: für Verständnisprobleme und Austausch über die Bücher und das ProjektRückmeldung zum Leseflüssigkeitstest im Einzelgespräch: für Transparenz, Einsicht in den eigenen Lernprozess und Erfolgserlebnisse |
Forschungsvorhaben
Um die wirkungsvollste Art des Lesetrainings zu ermitteln, wurden in allen Klassen Leseflüssigkeitstests zur Gruppendiagnostik zu drei verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt. Das Verfahren wird so durchgeführt, dass die Schüler/innen den ausgeteilten Text auf das Startsignal der Lehrperson schnellstmöglich lesen, während die Lehrperson das Voranschreiten der Zeit an einem Zeitstrahl an der Tafel anzeigt. Nach Beendigung ihres Leseprozesses schreiben die Schüler/innen ihre benötigte Zeit auf den Testbogen. Lücken im Text sollen sicherstellen, dass der Text sinnentnehmend gelesen wird (vgl. Rosebrock et al. 2011: 93).
Da Klasse A das Hauptforschungsinteresse galt, wurden in dieser Klasse zusätzlich Tonaufnahmen zur Beobachtung der Dekodierfähigkeit durchgeführt sowie die Würzburger Leise Leseprobe - Revision zur Untermauerung der Ergebnisse der Leseflüssigkeitstests.
Ergebnisse
Während des Projektzeitraums verbesserten sich alle Klassen in Bezug auf die Lesegeschwindigkeit, gemessen in Wörtern pro Minute (WpM), wobei sich ausschließlich die beiden Projektklassen in signifikantem Maße verbesserten, was für den Erfolg beider Projekte spricht.
Die Würzburger Leise Leseprobe – Revision korrelierte mit den selbst entwickelten Leseflüssigkeitstests und unterstrich damit deren Bedeutsamkeit. Die durchgeführten Tonaufnahmen wiesen auf eine Verbesserung der Automatisierung der Dekodierfähigkeit von Klasse A durch das Training mit Büchern + Audiomaterial hin.
Wie erwartet verbesserte sich die Lesegeschwindigkeit in den Klassen in abgestuftem Maße, wobei sich Klasse A im höchsten Maße und Klasse C in geringstem Maße verbesserte. Auch wenn die Unterschiede im jeweiligen Leistungszuwachs nicht im wissenschaftlichen Sinne als signifikant zu bezeichnen sind, weist die graduelle Steigung der Verbesserung der Lesegeschwindigkeit von Klasse C zu Klasse B hin zu Klasse A eher auf einen verstärkten Kompetenzzuwachs bei den Kindern mit Audiomaterial hin.
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test1 à Test3 | |
| Klasse A | 61,5 WpM | 78,2 WpM | 77,4 WpM | + 15,8 WpM |
| Klasse B | 43,6 WpM | 53,3 WpM | 56,0 WpM | + 12,4 WpM |
| Klasse C | 62,1 WpM | 80,5 WpM | 72,8 WpM | + 10,7 WpM |
Durchschnittliche Lesegeschwindigkeit in den Testklassen
Umsetzung in die Praxis
Generell lässt sich das Projekt bei erschwinglichen Materialkosten sehr gut in den Regelunterricht implementieren. Aufgrund dieses Potentials zur Förderung basaler Lesefertigkeiten stellt das Leseflüssigkeitstraining mit Hörbüchern einen möglichen Baustein der Leseförderung dar, der Fördermaßnahmen auf hierarchiehöheren Ebenen der Lesekompetenz ermöglicht und begünstigt. Mit steigender Herausforderung, beispielsweise durch eine gestiegene Anzahl an Kindern, die Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache lernen, steigt auch die Notwendigkeit differenzierter, systematischer Leseförderung. Das Lesetraining mit Hörbüchern könnte besonders für diese Kinder eine Unterstützung zur Wortschatzerweiterung, richtigen Aussprache und Betonung sein (vgl. Krafft/Geist 2017: 64f).
Dementsprechend wird das Lesetraining mit Hörbüchern, wie es hier beschrieben wurde, als ein Element in einem größeren Konstrukt von vielen Leseförderungsmaßnahmen gesehen, die aneinander anknüpfen und sich ergänzen sollten.
Literaturverzeichnis
Gailberger, S. (2011): Lesen durch Hören. Leseförderung in der Sek. I mit Hörbüchern und neuen Lesestrategien. Weinheim; Basel: Beltz Verlag
Gailberger, S. (2013): Systematische Leseförderung für schwach lesende Schüler. Zur Wirkung von lektürebegleitenden Hörbüchern und Lesebewusstmachungsstrategien. Weinheim; Basel: Beltz Juventa
Groeben, N. (1982): Leserpsychologie. Textverständnis – Textverständlichkeit. Münster: Aschendorff
Kawohl, E. (2015): Diagnosebasierte individuelle Leseförderung in der Grundschule. Implementation von Lernverlaufsdiagnostik und individualisierter Instruktion und deren Wirksamkeit auf die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis von Dritt- und Viertklässlern. Hamburg: Verlag Dr. Kovac
Klicpera, C./ Gasteiger-Klicpera, B. (1993): Lesen und Schreiben. Entwicklung und Schwierigkeiten. Bern: Verlag Hans Huber
Krafft/ A./ Geist, B. (2017): Deutsch als Zweitsprache. Sprachdidaktik für mehrsprachige Klassen. Tübingen: Narr Francke Attempto
Nix, D. (2011): Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautlese-Verfahrens im Deutschunterricht. Weinheim; München: Juventa Verlag
Rosebrock, C./ Nix, D. (2006): Forschungsüberblick: Leseflüssigkeit (Fluency) in der amerikanischen Leseforschung und -didaktik. Didaktik Deutsch, 20, S. 90 – 113.
Rosebrock, C./ Nix, D. (2014): Grundlagen der Lesedidaktik und er systematischen schulischen Leseförderung. 7. Aufl. Hohengehren: Schneider Verlag
Rosebrock, C./ Nix, D./ Rieckmann, C./ Gold, A. (2011): Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe. Seelze: Friedrich Verlag
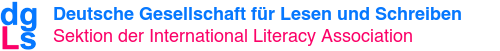

Christoph Jantzen
Gibt es eigentlich Mitgliederinnen? Geschlechtersensitive Sprache
Hanna Sauerborn
Frage des Monats: Leseflüssigkeit fördern
Erika Altenburg
Frage des Monats: Leseflüssigkeit fördern
Sabine Birck
Frage des Monats: Leseflüssigkeit fördern
Hans Brügelmann
Frage des Monats: Leseflüssigkeit fördern